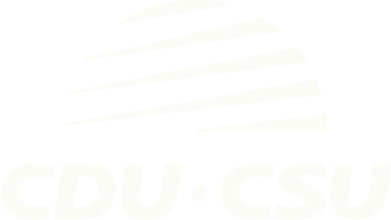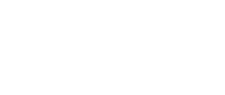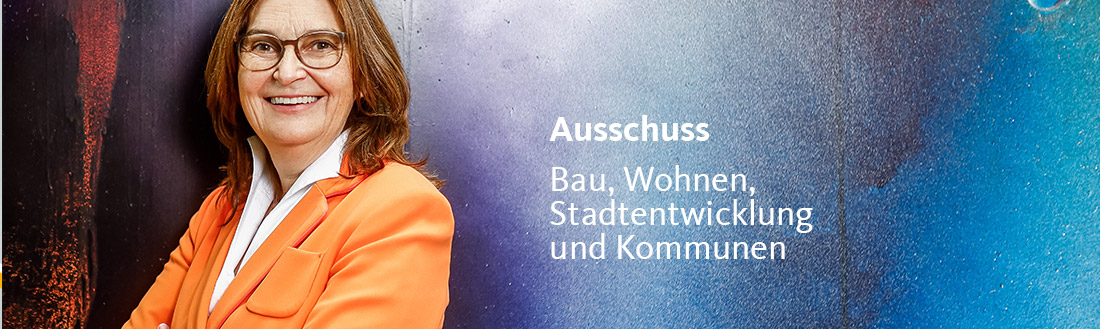
In der aktuellen 21. Wahlperiode bin ich erneut ordentliches Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz.
Entscheidungen des Deutschen Bundestages werden in den Ausschüssen vorbereitet, die in jeder Wahlperiode neu eingesetzt werden. Vier von ihnen verlangt das Grundgesetz: die Ausschüsse für Auswärtiges, für Verteidigung, für die Angelegenheiten der Europäischen Union sowie den Petitionsausschuss. Gesetzlich vorgegeben sind auch der Haushaltsausschuss und der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung (auch 1. Ausschuss genannt). Der fachliche Zuschnitt der Ausschüsse entspricht weitgehend der Ressortverteilung der Bundesregierung. Auf diese Weise wird dem Parlament eine wirksame Kontrolle der Regierung ermöglicht.
Der Ausschuss zählt 30 ordentliche Mitglieder: Die CDU/CSU-Fraktion ist in dem Gremium mit zehn Parlamentariern vertreten, die AfD-Fraktion mit sieben, die SPD-Fraktion mit sechs, die Fraktion Bündnis90/Die Grünen mit vier und die Fraktion Die Linke mit drei Abgeordneten.
Den Herausforderungen denen wir politisch begegnen, sind unterschiedlich: Während einige Kommunen mit rückläufigen Bevölkerungszahlen und Leerständen zu kämpfen haben, geht es auf dem Wohnungsmarkt in Ballungsräumen darum, neuen und vor allem bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die Bau- und Wohnpolitik muss also gleichermaßen die Interessen der ländlichen wie der städtischen Kommunen in den Blick nehmen. Gleichwertige Lebensverhältnisse, lebendige Städte und Gemeinden, aber auch bezahlbares Wohnen, die Förderung von Eigentum, das Aktivieren von Bauland und der Bürokratieabbau bis hin zum Umgang mit alter Bausubstanz sind mir als Architektin eine Herzensangelegenheit. Für mich beinhalten die Fragen nach Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen immer auch soziale, kulturelle, wirtschaftliche und umweltpolitische Aspekte.